Die Mechanik der Morez-Uhren (Autor
Emil Hänseler)
Aufbau, Hemmungen und Schlagwerk
Die "Morez" ist ein Zeitmesser mit Pendel und Gewichtzug. Das Gewicht hängt am
Ende einer Hanfschnur, die mit einer Kurbel auf die Schnurtrommel gewickelt wird. In der
ersten und zweiten Uhren-Generation bestehen die Trommeln aus Holz, nachher aus Messing.
Das Uhrwerkgestell ist aus Eisen. Vier Träger aus Flachstahl tragen die Triebwellen mit
den Messingrädern. Die zwei Triebwerke, eines für das Gehwerk und eines für das Schlagwerk, sind nebeneinander angeordnet, das Gehwerk (vom
Zifferblatt her gesehen) links, das Schlagwerk rechts. Berechnet sind sie für eine
Gangdauer von einer Woche.
- Uhren der ersten, zweiten und dritten Generation haben eine Spindelhemmung (oberes Bild), jene der vierten Generation eine Ankerhemmung (unteres Bild). Die Ankerhemmung ermöglicht ein
verschleissärmeres Bewegen des schwereren Pendels dieser Uhren.
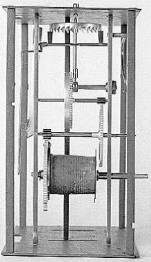 |
Die
Spindelhemmung
Das Gehwerk der Morez-Uhr mit Spindelhemmung,
wie sie von der ersten bis zur dritten Generation angewendet wurde. Zwei Spindellappen
regulieren - vom Pendel gesteuert - den Ablauf der Zeit.
|

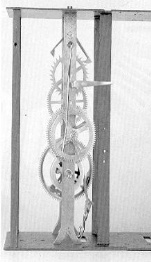 |
Die Ankerhemmung
In der vierten Generation wurden die Uhren mit
einer Ankerhemmung gebaut. Diese ermöglichte die Verwendung des schwereren Lyrapendels.
|

Das Rechenschlagwerk
bewirkt die Intelligenz der Morez-Uhr. Sie schlägt immer die Stunde, auf welche der
Zeiger auf dem Zifferblatt weist. Die "Morez" schlägt die vollen Stunden und
die Halbstunden. In der Regel repetiert sie nach etwa zwei Minuten den Stundenschlag. Bei
gewissen Baumustern kann der volle Stundenschlag mit einer Zugschnur manuell wiederholt
werden. Der relativ laute Glockenschlag war damals für die Bauernhöfe wie geschaffen,
denn er war in allen Gebäuden zu hören. (In den heutigen Stadtwohnungen dämpft man ihn
normalerweise.)
- In den ersten zwei Uhren-Generationen sind die
Uhrwerk-Gestelle meistens 24,5 cm hoch, 24 cm breit und 14,5 cm tief. In der dritten
Generation betragen diese Masse oft 32 x 27,5 x 15 cm.
Eine Rückwand und zwei Seitentüren schützen das Werk vor
Staub. In der dritten Uhren-Generation werden die bisher schmucklosen Seitentüren
gelegentlich mit einfachen Ornamenten verziert.
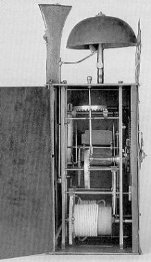 |
Einblick in
das Gehäuse
Das Gewicht treibt über die Schnur und
Schnurtrommel das Gehwerk mit der Spindelhemmung. Auffallend ist die hohe Aufhängung der
Pendelstange hinter der Glocke.
|
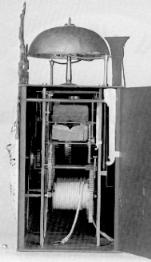 |
Seitenansicht des Schlagwerks
Gut sichtbar (Bildmitte) ist der Windflügel,
der für einen langsamen, gleichmässigen Schlag sorgt. Zwei verschiedene Hämmer schlagen
die Halb- bzw. die volle Stunde.
|

Das Pendel
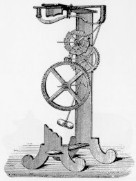 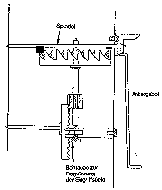 Ein grosser Nachteil der Waag als dem bis spät ins
17. Jahrhundert absolut vorherrschenden Zeitnormal war ihre geringe Genauigkeit, denn die
Waag führt ja lediglich eine durch den Uhrwerksantrieb erzwungene Schwingung aus.
Infolgedessen kann sie keine gleichmässige Schwingungsdauer gewährleisten, zumindest
solange der Antrieb nicht absolut gleichmässig ist. Nachdem Galilei den
Isochronismus - die fast gleiche Dauer auch unterschiedlich weiter Schwingungen - erkannt
hatte, und mit zunehmender Bedeutung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse, war die
Benützung des Pendels zur Zeitmessung fast zwangsläufig (Modell - Bild
links). Ein grosser Nachteil der Waag als dem bis spät ins
17. Jahrhundert absolut vorherrschenden Zeitnormal war ihre geringe Genauigkeit, denn die
Waag führt ja lediglich eine durch den Uhrwerksantrieb erzwungene Schwingung aus.
Infolgedessen kann sie keine gleichmässige Schwingungsdauer gewährleisten, zumindest
solange der Antrieb nicht absolut gleichmässig ist. Nachdem Galilei den
Isochronismus - die fast gleiche Dauer auch unterschiedlich weiter Schwingungen - erkannt
hatte, und mit zunehmender Bedeutung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse, war die
Benützung des Pendels zur Zeitmessung fast zwangsläufig (Modell - Bild
links).
Die um 1640 von Galilei beschriebene
Pendelhemmung erlangte noch keine (wirtschaftliche) Bedeutung. Ihre Funktionsfähigkeit
ist jedoch bereits durch die wesentlichen Merkmale der späteren Hemmungen bestätigt: Ein
weitgehend frei schwingendes Pendel, das vom Uhrwerk in Schwingung gehalten wird, dieses
aber gleichzeitig hemmt. Der Holländer Huygens führte 1656 die
Pendelschwingung mit einer modifizierten Spindelhemmung ein. Er baute Spindelrad und
Spindel horizontal in das Uhrwerk ein und koppelte die Bewegung der Spindel mit der
Pendelschwingung (Bild rechts).
   Birnenpendel (links) bestimmen den Gang der Uhren, die zwischen 1680 und
1830 gebaut wurden. Das Bleigewicht am Ende einer Kette aus Drahtgliedern schwingt hinter
den Gewichten. Birnenpendel (links) bestimmen den Gang der Uhren, die zwischen 1680 und
1830 gebaut wurden. Das Bleigewicht am Ende einer Kette aus Drahtgliedern schwingt hinter
den Gewichten.
-
- Das Scheibenpendel (oder Linsenpendel) ist ein Merkmal der
dritten Uhren-Generation (1820 bis 1860). Bei frühen Uhren der 3. Generation schwingt
es noch hinter, nach 1835 - 1840 vor den Gewichten. Die Stange lässt sich zum
Transportieren falten.
-
- Das Lyrapendel (3. von rechts), Merkmal der vierten
Uhren-Generation (1850 bis 1915): Was anfangs nur den Zweck hatte, den Gang des Werkes zu
steuern, wird hier zu einem Dekorationselement. Am Rost aus fünf bis elf Eisen- und
Messingstäben ist eine grosse polierte Linse befestigt. Ein zusätzliches Schmuckelement,
die Lyra, prägt den Namen "Lyrapendel".
Das Prachtpendel: Nach 1860 erscheinen
prunkvolle, 25 bis 35 cm breite Pendel auf dem Markt. Das Bild (rechts) ist ein Ausschnitt
aus dem Katalog einer spezialisierten Stanz- und Prägewerkstatt in Morbier.

 - Gewichte aus Stein, Blei oder, vor allem, aus Eisenguss
liefern die Kraft, damit die Uhr läuft. Jedes Gewicht wiegt 3,5 bis 5 Kilo. Spindeluhren
brauchen leichtere, Ankeruhren schwerere Gewichte.
- Von links n. rechts: (1) Blei, (2) Eisenguss alt, (3) Stein,
(4 und 5) Eisenguss "moderne" Form, (6 und 7) 19. Jahrhundert, (8 und 9) 18.
Jahrhundert
Auch die Gewichte haben sich im Laufe der Zeit verändert.
- 1700 bis 180
Konische, längliche Form, oben sphärisch, unten roh und porös, mehr oder weniger flach
16 bis 21 cm hoch
2,5 bis 3,5 kg
|
1750 bis
1850
Oben eiförmig, unten flach, gute Qualität
15 bis 18 cm hoch
4 kg |
1800 bis 1915
Oben eiförmig, regelmässig zylindrisch
18 bis 20 cm hoch
3,750 bis 4.5 kg |
Die Gewichte für Uhren "à grandes
complications" und 1 Monat-Werk können 7 bis 8 kg schwer sein.

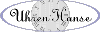
 Sammler-Ecke Sammler-Ecke
 Groß-Uhren Groß-Uhren
|
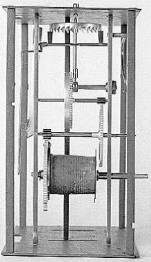
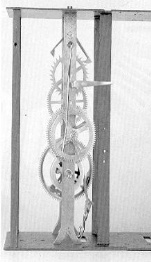
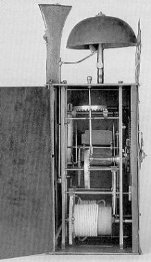
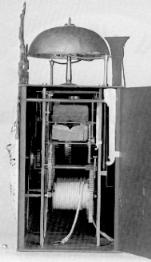
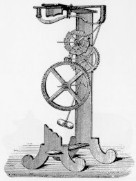


 Birnenpendel (links) bestimmen den Gang der Uhren, die zwischen 1680 und
1830 gebaut wurden. Das Bleigewicht am Ende einer Kette aus Drahtgliedern schwingt hinter
den Gewichten.
Birnenpendel (links) bestimmen den Gang der Uhren, die zwischen 1680 und
1830 gebaut wurden. Das Bleigewicht am Ende einer Kette aus Drahtgliedern schwingt hinter
den Gewichten. 