1. Vorwort
In der Ausstellung des Deutschen
Uhrenmuseums in Furtwangen [10] findet der Besucher eine Wanduhr mit elektrisch
angetriebenem Torsionspendel, hergestellt nach Patenten von Rabe aus Hanau.

Bild 01 (Bild zum
Vergrößern bitte anklicken)
Elektrische Torsionspendeluhr Nr. 176 nach Patent Rabe.
Mit freundlicher Genehmigung des Deutschen Uhrenmuseums Furtwangen, Inventarnummer
50-0265.
Als Freund elektrischer Uhren war ich
begeistert von dieser sehr eigenwilligen, aber auch einzigartigen Uhr und mein Wunsch war
es, mehr über die Geschichte des Hanauer Uhrenherstellers zu erfahren. Leider mußte ich
sehr bald feststellen, daß der Uhrenhersteller aus Hanau selbst in Fachkreisen völlig
unbekannt war. Ich begab mich deshalb selbst auf die Suche nach den historischen Wurzeln
der Hanauer Uhrenfabrikation.
Die Datensuche begann zunächst in der
verfügbaren Fachliteratur. In den frühen Lehrbüchern der elektrischen Uhrmacherei
findet man bei Merling [09] einen kurzen Hinweis auf ein elektrisches Geh- und Schlagwerk
von Rabe. In der Deutschen Uhrmacher Zeitung(=DUZ) findet man Hinweise [02] [07] auf
erfolgte Patenterteilungen, einen Leserbrief eines Uhrmachers [04] zu dem Kontaktsystem
der Uhren und mehrere Anzeigen [08] einer Hanauer elektrischen Uhrenfabrik - Steinheuer
& Rabe. In den Hersteller- und Meisterverzeichnissen von Abeler [01] und Schraven [19]
wird die Uhrenfabrikation in Hanau erwähnt. Damit war das Potential verfügbarer
Literatur vorerst erschöpft.
Im Jahre 1992 wurden erste Kontakte zum
Hanauer Stadtarchiv geknüpft. Da die Stadt Hanau selbst Interesse an der Erforschung der
eigenen Industriegeschichte hat, wurde mir jede nur denkbare Unterstützung gewährt.
Verschiedene andere Institutionen der Stadt wurden später angesprochen und letztendlich,
die Bevölkerung Hanaus durch eine Anzeige im Hanauer Anzeiger zur aktiven Mitarbeit
animiert [29]. Immer wieder ergaben sich neue Ansatzpunkte für weitere Untersuchungen.
Selbstverständlich wurde meine Suche auch von anderen Uhrenfreunden unterstützt.
Mittlerweile ermöglichen die bisher
gefundenen Daten, Uhren und historischen Details einen Einblick in die Geschichte des
Hanauer Uhrenherstellers, die im Jahre 1847 beginnt.

2. Die Gebrüder Rabe, Heinrich und
Eckard Rabe
Im Hanauer Anzeiger [23] vom 25.11.1847
wird bekanntgegeben, daß sich der Uhrmachermeister Karl Hochreuther (8.4.1819-23.5.1865)
selbständig macht und ein eigenes Geschäft in Hanau in der Frankfurter Straße 17
eröffnet. Hochreuther arbeitet dort als Uhrmacher und Emailleur. Auch der Vater von Karl
Hochreuther, Cornelius Hochreuther, arbeitete bereits als Uhrmacher in Hanau.
1863 stellt Karl Hochreuther den Uhrmacher
Heinrich Rabe (13.6.1842 - 3.1.1911) als Mitarbeiter ein [25]. Noch im gleichen Jahr wird
Heinrich Rabe Bürger der Stadt Hanau [24] und kann nach dem Tode Hochreuthers am
23.5.1865 dessen Geschäft übernehmen [18] [26]. Die Witwe von Karl Hochreuther
befürwortet diese Geschäftsübernahme durch Heinrich Rabe [25].
"Dem Uhrmacher Heinrich
Rabe aus Braunau bei Wildungen, welcher während 3 Jahren in dem Uhrmachergeschäfte
meines seeligen Mannes als Geschäftsgehilfe ununterbrochen thätig war und gegenwärtig
auch bei mir als solcher arbeitet, bezeuge ich hiermit, daß er sehr tüchtig ist und
durch seinen Fleiß und gutes Betragen sich sehrwohl meine als auch meines Mannes volle
Zufriedenheit erworben hat"
Hanau den 12. August 1865
Katrina Hochreuther, Witwe
Die Firma Heinrich Rabe wird am 12.4.1866
offiziell in das Handelsregister eingetragen [44].
1867 heiraten Heinrich Rabe und Johanna
Margarete Auguste Hochreuther. Johanna Hochreuther ist die Tochter des Hanauer
Bijouteriefabrikanten Franz Hochreuther [13].
Die Hanauer Adreßbücher (Auflistung im
Anhang) der damaligen Zeit dokumentieren die geschäftlichen Aktivitäten von Heinrich
Rabe relativ genau.
Zuerst besteht die Tätigkeit des
Uhrmachers Rabe vorrangig aus Uhrenhandel und Uhrenreparatur. Zwei Mal zieht das Geschäft
innerhalb der nächsten Jahre um. Als Geschäftsanschrift wird 1869 die Hammergasse 5 und
ab 1876 die Steinheimer Str. 41 genannt.
Eine besondere Attraktion für die Hanauer
Bevölkerung war damals eine Augenwender- und Knödelfresseruhr, die Heinrich Rabe im
Januar 1869 in seinem Schaufenster ausstellte [27]:
"27.1.1869: Von heute an
zieht nun im Schaufenster des Uhrmachers Heinrich Rabe in der Hammergasse 5 die
ausgestellte Uhr mit Automat, ein sitzendes Männlein, welches Klöße mit einem Löffel
verspreißt und dabei die Augen verdreht, das Publikum in Massen herbei".
In den darauffolgenden Jahren verläßt
Uhrmacher Rabe den Bereich der klassischen Uhrmacherei. Motiviert von den Erfolgen der
Naturwissenschaften in allen Bereichen der Technik, beschäftigt sich Heinrich Rabe nun
auch mit der Elektrizitätslehre. Diese steckte zu dieser Zeit zwar noch in den
Kinderschuhen, machte aber rasante Fortschritte und wurde sehr erfolgreich vermarktet.
Für diese Tätigkeit gibt es eindeutige Belege.
Während der Jahre 1875 - 1880 wurde das
Schloß Philippsruhe/Hanau modernisiert und umgebaut. Der Uhrmacher Rabe erhielt
zahlreiche Aufträge, sowohl als Elektrotechniker als auch als Uhrmacher [35], [39]:
- 1876 Reparatur und Restauration von 16 Uhren aus dem
Jagdschloss Wabern
- 1877 Installation einer neuen Blitzableiteranlage für das
Schloss Philippsruhe
- 1878 Einbau einer neuen Turmuhr (diese Uhr wurde später
durch eine Uhr von Korfhage ersetzt)
- 1879 Bau einer aufwendigen Wanduhr für die
Bibliotheksräume
- 1880 Einbau einer hauseigenen Telegraphenanlage für 3
Etagen des Schlosses
 |
1 neue Uhr in die
Bibliothek M 600.- Die
Richtigkeit und gute Ausführung der Arbeit zur Bibliotheks Uhr so mir die
Übereinstimmung des Preises mit dem vorher vereinbarten bescheinigt und die Rechnung
festgestellt ist "Sechshundert Mark" Philipppsruhe den 26. August 1880
der Architekt der Bauführer
Sechshundert Mark aus der landgräflichen
Hofkasse empfangen zu haben, quittiert:
Philippsruhe den 7. September 1880
Gebr. Rabe |
Bild 02 (Bild zum Vergrößern bitte
anklicken)
Rechnung der Gebrüder Rabe vom 11. August 1880 [39].
Auch später erhalten die Gebrüder Rabe
noch Aufträge vom hessischen Landgraf. Ca. 1885 wird eine Uhr an das Schloß geliefert
und im Eingangsbereich installiert. Diese Uhr kommt allerdings nicht aus der Werkstatt
Rabe, sondern wurde von der Firma L. Furtwängler & Söhne AG/Furtwangen im
Schwarzwald [30] hergestellt. Es handelt sich hier um eine Uhr mit mechanischem Gehwerk
und 2 Ziffernblättern. Die Uhr ist bis heute im Originalzustand erhalten geblieben und
zeigt immer noch zuverlässig die Zeit an.

1878 erhält Heinrich Rabe den Titel
"Hofuhrmacher Seiner Königlichen Majestät des Landgrafen Friedrich von
Hessen".
Im gleichen Jahr wird auch das DRP 4716,
Rufapparat für Telephone, angemeldet.
Registriert wird in dieser Zeit erneut eine
Ausweitung des Lieferprogramms. Neben Uhren und elektrischen Apparaten werden jetzt auch
optische Waren, wie Brillen, Lupen, Mikroskope und Fernrohre angeboten.
Unterstützung erhält Heinrich Rabe von
seinem jüngeren Bruder Eckard (30.12.1852 – 7.3.1897). Ab dem Jahre 1878 beteiligt
sich dieser an den geschäftlichen Aktivitäten der Firma Rabe. Eckard und Heinrich Rabe
arbeiten nun gemeinsam unter dem Namen Gebrüder Rabe. Auch Eckard Rabe ist Hofuhrmacher
des Landgrafen von Hessen [13].
Es ist nicht verwunderlich, daß die
innovativ denkenden Uhrmacher Rabe versuchten, ihre elektrotechnischen Kentnisse auch im
Bereich der Uhrmacherei anzuwenden. Die Gebrüder Rabe beginnen mit der Entwicklung
eigener elektrischer Uhren. Eine genaue Datierung dieser Tätigkeit ist heute leider nicht
möglich, weil die Adreßbücher der Jahre 1879-1882 nicht mehr vorhanden sind. Im
Adreßbuch des Jahres 1883/84 ist jedoch zum ersten Mal der Hinweis zu finden, daß
elektrische Uhren nach eigenen Patenten konstruiert und angeboten werden.
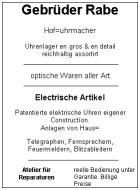
Bild 03 (Bild zum
Vergrößern bitte anklicken)
Anzeige aus dem Hanauer Adreßbuch für das Jahr 1888/89 [18].
Nachweisbar sind in diesem Zusammenhang
mehrere Patente der Gebrüder Rabe. In den Jahren 1882 - 1898 wurden alleine im deutschen
Reich 8 Patente in der Patentklasse 83b bzw. 74a erteilt [19]. Weiterhin wurde im Jahre
1884 ein Patent in England [11] und 1885 ein Patent in den Vereinigten Staaten von Amerika
[20] angemeldet. Eine vollständige Auflistung der Patente ist im Anhang zu finden.
Die Hälfte der im deutschen Reich
erteilten Patente behandeln elektromechanische Torsions- und Rotationspendeluhren.
Versucht wurde, ein mechanisches Uhrwerk mit elektrischen Kräften anzutreiben. Die
Erfindungen beinhalten zwei grundsätzlich verschiedene Systeme. Während sich die
früheren Patente auf den direkten elektrischen Antrieb von Torsions- und Rotationspendeln
beziehen, beinhalten die späteren Patente den elektrischen Aufzug des mechanischen
Uhrwerkes zum Antrieb von Torsions- oder Rotationspendeln.
Man kann davon ausgehen, daß die Nachfrage
nach den elektrischen Uhren der Gebr. Rabe damals relativ groß war. Die bestehenden
Produktionskapazitäten in der Werkstatt Rabe reichten bald nicht mehr aus. Um diese zu
erweitern, wurde eine eigene Produktionsstätte, die "Hanauer elektrische Uhrenfabrik
Steinheuer und Rabe" gegründet. Da der Hanauer Uhrenfabrik ein eigenes Kapitel
gewidmet ist, soll an dieser Stelle auf detaillierte Ausführungen verzichtet werden.
Bereits 1893 wird die Uhrenfabrik in Hanau
nicht mehr erwähnt. Die Gebrüder Rabe bieten jedoch noch in den Jahren 1893/94
elektrische Uhren aus eigener Herstellung an. Nach 1894 werden nur noch elektrische Uhren
und Zeigerwerke angeboten. Der Hersteller dieser Uhren wird dabei nicht näher bezeichnet.
Im Jahre 1897 verstirbt Eckard Rabe und
Heinrich Rabe ist wieder alleiniger Inhaber des Geschäftes. Kurz nach der
Jahrhundertwende werden alle Aktivitäten im Bereich der elektromechanischen Uhrmacherei
eingestellt.
Ab 1905 werden die Gebrüder Rabe Mitglied
der Uhrenfabrikations- und –handels Gesellschaft Union Horlogère.

Am 3.1.1911 verstirbt auch Heinrich Rabe
und seine Töchter, Maria Coquot (24.5.1871 - ?.6.1949) und Luise Sauer (27.11.1873 –
17.2.1955) werden ab dem 1.4.1911 Inhaberinnen des Geschäftes in der Steinheimer Straße.
Maria Rabe war mit dem Kaufmann Louis
Coquot verheiratet und Luise Rabe mit dem Uhrmacher Balthasar Sauer [32]. Louis Coqout und
Balthasar Sauer führen gemeinsam das Geschäft der Gebrüder Rabe [28] [34]. Das
Meisterstück von Balthasar Sauer, ein Regulator mit Sekundenpendel, ist bis heute
erhalten geblieben [31].
Schwerpunkte der geschäftlichen Tätigkeit
sind Uhren, Optik und Rundfunkgeräte.
Kurz vor Ende des Krieges, am 19.3.1945,
wird Hanau zu 90 % zerstört. Auch das Geschäft der Gebrüder Rabe fällt diesem Wahnsinn
zum Opfer. Nach dem Krieg wird ein provisorisches Geschäft in der Kronprinzenstrasse 10
betrieben. Im Jahre 1950 wird das Geschäft der Gebrüder Rabe am Heumarkt 3 (ehemalige
Anschrift von Eckard Rabe) neu eröffnet. Nach dem Tod von Luise Sauer am 17.2.1955 [36]
wird das Geschäft der Gebrüder Rabe aufgegeben.

3. Hanauer elektrische Uhrenfabrik
Steinheuer und Rabe
Im Adreßbuch des Jahres 1886/87 wird die
Hanauer elektrische Uhrenfabrik zum ersten Mal offiziell erwähnt. Es ist aber sehr
wahrscheinlich, daß die Uhrenfabrik schon 1885 gegründet wurde. Eine Anzeige in Hanauer
Anzeiger vom 11.7.1885 [45] belegt dies:
Einige junge Leute vom Lande im
Alter von 14-16 Jahren finden Beschäftigung in der Fabrikation von Großuhren
Gebrüder Rabe
Als Inhaber der Fabrik werden Eckard und
Heinrich Rabe gemeinsam mit Julius und Heinrich Steinheuer genannt. Als Anschrift wird die
Lindengasse 6 angegeben.
Auch die Steinheuers sind bekannte
Fabrikanten aus Hanau. Louis August Steinheuer [16] gründete 1838 die Bijouterie- und
Kettenfabrik Steinheuer & Co. in Hanau am Marktplatz 11. Diese Fabrik wird am 8.12
1887 [43] von seinen Söhnen Julius (10.12.1850 - 5.1.1913) und Heinrich (4.11.1846 - ?)
übernommen. Gemeinsam führen diese die Fabrik, bis 1891 Heinrich Steinheuer nach Amerika
auswandert. Die Bijouterie- und Kettenfabrik Steinheuer & Co. wird danach von Julius
Steinheuer alleine weitergeführt. Im Jahre 1910 wird die Fabrik noch erwähnt [15].
Als Bijouteriefabrikanten hatten die
Steinheuers eigentlich keinen direkten Bezug zu Uhren bzw. zur Uhrmacherei. Gefunden
wurden jedoch 2 Patente [19] von Julius Steinheuer aus den Jahren 1889 und 1890, die
dokumentieren, daß sich dieser ernsthaft mit der elektrischen Uhrmacherei
auseinandersetzte.
Welche genaue Bedeutung J. und H.
Steinheuer für die Hanauer elektrische Uhrenfabrik hatten, konnte bisher noch nicht
eindeutig geklärt werden. Man kann aber vermuten, daß die Familie Steinheuer finanzielle
Mittel zur Verfügung stellten. Ein Beleg für diese Annahme könnte sein, daß sich die
Handelsniederlassung der Hanauer elektrischen Uhrenfabrik am Marktplatz 11, also auf dem
Gelände der Bijouteriefabrik Steinheuer, befand.
Durch die Gründung der Hanauer Uhrenfabrik
änderte sich auch die Patentsituation. Bisher bestand Patentschutz für die Erfindungen
von Heinrich Rabe bzw. der Gebrüder Rabe im Deutschen Reich, England und in den
Vereinigten Statten von Amerika. Ab 1887 werden nun gemeinsam Patente im Ausland auf den
Namen Hanauer elektrische Uhrenfabrik angemeldet. Es handelt sich um das Patent 011 191 in
England [11] und das Patent 401 065 in Amerika [20]. Beide Patente beschreiben eine
Verbesserung des DRP 039 589 der Gebrüder Rabe.

Die Adreßbücher geben weitere Auskunft
über das Fortbestehen der Hanauer elektrischen Uhrenfabrik. Namentlich wird die Fabrik
nur noch im Jahrgang 1888/89 genannt. Bereits im Adreßbuch für 1890/91 wird unter der
Rubrik Lindengasse eine nicht näher bezeichnete Uhrenfabrik genannt. Im Band des Jahres
1892/93 wird wiederum eine elektrische Uhrenfabrik in der Rubrik Lindengasse angegeben
aber gleichzeitig auch eine Fabrik elektrischer Uhren und Apparate, allerdings ohne
Anschrift in der Rubrik Uhrmacher. Es dürfte sich aber in beiden Fällen um die gleiche
Fabrik handeln. In den Jahren nach 1893 wird eine Uhrenfabrikation in Hanau garnicht mehr
erwähnt.
Es wurde nun versucht, anhand der
vorhandenen Quellen eine Deutung dieser Eintragungen zu ermöglichen.
Im Jahrgang 1889 der Deutschen Uhrmacher
Zeitung [08] sind mehrere Verkaufsanzeigen der Hanauer Fabrik abgedruckt und in der
niederländischen Uhrmacherzeitung De Horlogenmaker [37] ist eine detaillierte
Beschreibung der Torsionspendeluhr zu finden.


Bilder 04 a + b
(Bilder zum Vergrößern bitte anklicken)
Anzeigen der Hanauer elektrischen Uhrenfabrik 1889 [08].
Diese Werbekampagne für das Jahr 1889
dokumentiert die Erwartungen aller Beteiligten an das Projekt - Hanauer elektrische
Uhrenfabrik.
Die Hanauer Uhrenfabrik stellte qualitativ
sehr hochwertige und eigenwillige Uhren her. Zum Antrieb des Uhrwerkes wurden die damals
vorhandenen Möglichkeiten der Elektrotechnik ausgenutzt. Diese elektrischen Einrichtungen
an den Hanauer Uhren waren wahrscheinlich auch die Ursache für das Scheitern dieser Uhren
auf dem Markt. Der Leserbrief eines Uhrmachers belegt, daß viele Hanauer Uhren zwar an
den Uhrenhandel ausgeliefert wurden, aber aufgrund technischer Probleme nicht an den
Endverbraucher weiterverkauft werden konnten [04]. Schwachpunkt waren immer Kontakte und
Batterien. Aber auch andere Hinweise verdeutlichen, daß das Kontaktsystem der Uhren von
Rabe nicht zuverlässig arbeitete. Bei der Besprechung des DRP 31 362 in der DUZ [07] wird
angegeben, daß die Gebrüder Rabe bereits an einer Verbesserung des elektrischen
Antriebes arbeiten.
Auch das Patent DRP 35 448 beschreibt eine
Modifikation des Pendelkontaktes nach Rabe. Die aufeinander gleitenden Metallteile des
Kontaktsystems werden nun durch einen Quecksilberschalter ersetzt.
Während über die Gründungsjahre der
Uhrenfabrik in Hanau relativ wenig bekannt ist, kann das Ende der Aktivitäten genau
rekonstruiert werden. Den entscheidenden Hinweis dazu fand ich vor 6 Jahren bei J. Steen
[12] "Eine neue Zeit, internationale elektrotechnische Ausstellung Frankfurt/M.
1891". Im Ausstellerverzeichnis findet man den Vermerk "Bohmeyer/Hanau". Da
Bohmeyer ein bekannter Fabrikant elektrischer Uhren aus Halle/Saale ist, ergibt sich
automatisch die Frage nach einem möglichen Zusammenhang zwischen Herrn Bohmeyer und der
Hanauer elektrischen Uhrenfabrik.

Auch in diesem Falle konnte das Stadtarchiv
in Hanau wieder excellente Auskünfte geben. Mit Hilfe des offiziellen Melderegisters der
Stadt konnte nachgewiesen werden, daß sich C. Bohmeyer aus Halle/Saale am 19.2.1891
offiziell in Hanau anmeldete [14]. Seine Familie, 3 weibliche Personen, begleiteten ihn.
Bohmeyer wohnte mit seiner Familie zunächst in der Lindengasse 8, also direkt neben der
Uhrenfabrik, zieht aber noch im gleichen Jahr in die Fallbachstraße 15 um.
Im gleichen Jahr findet in Frankfurt/M.
eine der bedeutendsten Industrieausstellungen, die Internationale Elektrotechnische
Ausstellung, statt. Unter den Ausstellern befindet sich auch C. Bohmeyer. Als
Geschäftsanschrift wird angeben, Fabrik für elektrische Uhren und Apparate in Hanau,
gegründet 1891 [12]. Die Hanauer elektrische Uhranfabrik - Steinheuer und Rabe wird im
Ausstellerverzeichnis nicht erwähnt.
Die von C. Bohmeyer ausgestellten Exponate
werden teilweise in der offiziellen Zeitung der internationalen elektrotechnischen
Ausstellung [03] abgebildet und beschrieben.

Bild 05 (Bild zum
Vergrößern bitte anklicken):
Elektrische Nebenuhr von Bohmeyer aus Hanauer Fertigung [03]
Ergänzende Informationen sind in der
Deutschen Uhrmacher Zeitung [06] von 1892 zu finden. Mitgeteilt wird dort, daß Bohmeyer
nur eine kleine Auswahl seiner Uhren auf der Ausstellung zeigen konnte, weil sich alle
Aktivitäten auf die Neueinrichtung einer Fabrikation konzentrierten. Erwähnt wird
weiterhin, daß ein Katalog zur Beschreibung der Produkte Bohmeyers vorbereitet wird. Es
ist möglich, daß es sich bei diesem Katalog um die erste Auflage des Buches
"Anleitung zur Aufstellung und Behandlung elektrischer Uhren [17]", publiziert
1892 in Hanau, handelt.

Von diesem Buch gibt es noch zwei spätere
Ausgaben aus den Jahren 1896 und 1908, die beim Emil Hübners Verlag in Bautzen
erschienen. Bohmeyer´s Buch von 1892 ist auch die nachfolgende Anzeige entnommen.
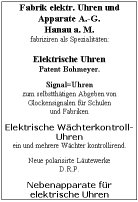
Bild 06 (Bild zum
Vergrößern bitte anklicken):
Anzeige von Bohmeyer aus dem Jahre 1892 [17].
Im Adreßbuch der Stadt Hanau wird Bohmeyer
nur für die Jahre 1892/93 erwähnt. Die Eintragung lautet: Karl Bohmeyer,
Elektrotechniker - Fallbachstr. 15.
Einige ergänzende Hinweise zu Bohmeyers
Fabrik in Hanau sind in der DUZ [06] des Jahres 1892 zu finden. Dort wird bestätigt, daß
in der Fabrik elektrischer Uhren und Apparate AG (vormals C. Bohmeyer) in Hanau
elektrische Uhren nach dem System Bohmeyer hergestellt wurden.

Am 29.9.1893 verläßt Bohmeyer Hanau und
reist zurück nach Halle/ an der Saale Ein Artikel über die elektrischen Uhren von
Bohmeyer in der DUZ [05] von 1894 belegt auch dies
"...der bekannte Fabrikant
Bohmeyer, welcher die nach seinem System konstruierten elektrischen Uhren jetzt
ausschließlich unter eigener Firma in Halle a.S. erzeugt, hat die ......"
Parallel zu den Hanauer Adreßbüchern
wurden auch die Adreßbücher [22] der Stadt Halle/S. ausgewertet. Bohmeyers Aktivitäten
im Bereich der elektrischen Uhrmacherei beginnen in Halle/S. im Jahre 1885 und lassen sich
bis zum Jahr 1950 weiterverfolgen. Besonders interessant sind dabei die Jahre 1891 - 1893,
während derer sich Bohmeyer in Hanau aufhielt.
Für die Jahre 1891/92 wird eine
Uhrenfabrikation Bohmeyers in Halle, Forsterstr. 16, erwähnt. Für das Jahr 1893 ist
keine Uhrenfabrikation Bohmeyers in Halle nachweisbar und ab 1894 wieder eine Fabrikation
in der Forsterstr. 40.
Elektrische Uhren von Bohmeyer aus dieser
kurzen Produktionsepoche in Hanau sind extrem selten zu finden. Ein glücklicher Zufall
spielte mir jedoch eine Nebenuhr aus der Hanauer Fertigung zu.
Diese Nebenuhr ist der in Bild 6 gezeigten
Uhr sehr ähnlich. Markantes Merkmal ist der als Dreibein ausgeführte Ständer der Uhr.
Alle Teile sind diesmal aus Holz gefertigt.
Das Uhrwerk selbst trägt die Signatur:
Bohmeyer/Hanau DRP A. 2028. Es handelt sich um ein geräuschlos arbeitendes
Schrittschaltwerk für polarisierte Minutenimpulse der Hauptuhr. Bohmeyer schreibt dazu in
seinem Buch [17], daß für diesen Uhrwerkstyp ein Patent beantragt wurde, das allerdings
im Jahre 1892 noch nicht erteilt war. Aus Gründen der Geheimhaltung wird das zugehörige
Nebenuhrwerk auch nicht näher beschrieben. Die Untersuchung beim Patentamt ergab, daß
Bohmeyer für dieses Uhrwerk keinen Patentschutz, sondern nur ein Gebrauchsmuster DRGM
erhielt. Ein fast identisches Nebenuhrgangmodell mit der Signatur: Bohmeyer/Halle ist mit
der zugehörigen DRGM 18 168 gestempelt.

Bild 07 (Bild zum
Vergrößern bitte anklicken):
Nebenuhrwerk Nr. 2028 von Bohmeyer aus Hanauer Fertigung 1891-1892.

|
